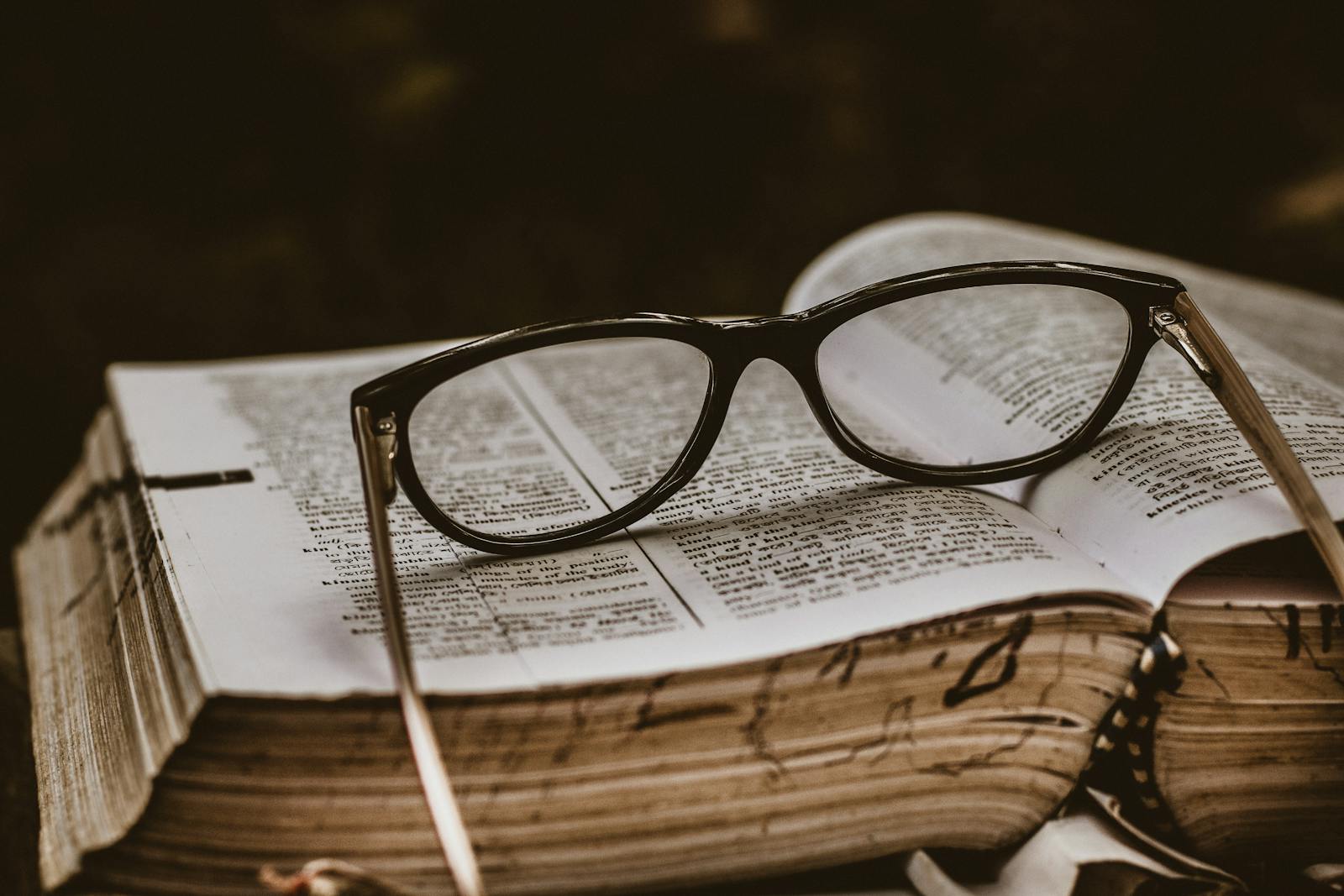Die Due Diligence (DD), zu Deutsch „sorgfältige Prüfung“, ist der entscheidende und oft gefürchtete Schritt in einer Finanzierungs- oder Verkaufsverhandlung. Sie ist der Prozess, bei dem ein potenzieller Investor oder Käufer ein Startup nach der Einigung auf die Grundzüge des Deals (meist im Term Sheet festgehalten) „auf Herz und Nieren“ prüft.
Der Zweck der Due Diligence ist es, alle vom Gründerteam gemachten Angaben zu verifizieren, die Annahmen der Bewertung zu validieren und vor allem versteckte Risiken (sogenannte „Red Flags“ oder „Deal Breaker“) aufzudecken. Für Gründer ist dieser Prozess ein „Offenbarungseid“, der den Deal bei schlechter Vorbereitung auch nach der Unterschrift auf dem Term Sheet noch zum Scheitern bringen kann.
Das Wichtigste in Kürze
- Was es ist: Die Due Diligence ist eine systematische Audit- und Risikoprüfungsphase, die ein Investor (VC, Business Angel) oder Käufer nach einem Term Sheet und vor der finalen Vertragsunterzeichnung durchführt.
- Das Ziel: Der Investor will alle Annahmen (finanziell, rechtlich, technisch) verifizieren und sicherstellen, dass keine „Leichen im Keller“ (z. B. Rechtsstreitigkeiten, IP-Probleme) existieren.
- Der Prozess: Der Prüfprozess wird meist von den Anwälten, Steuerexperten und Fachexperten des Investors geleitet und erfordert vom Startup die Bereitstellung eines umfassenden, virtuellen „Datenraums“ (Data Room).
- Die Konsequenz: Werden in der DD gravierende Mängel („Red Flags“) gefunden, kann der Investor den Deal platzen lassen, Nachverhandlungen (z.B. niedrigere Bewertung) fordern oder zusätzliche Garantien im Vertrag verlangen.
Die Kernbereiche der Due Diligence
Gründer müssen sich darauf einstellen, dass die Investoren-Teams (oft spezialisierte Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer) jeden Winkel des Unternehmens durchleuchten. Die DD unterteilt sich typischerweise in mehrere Bereiche:
1. Legal Due Diligence (LDD)
Dies ist oft der aufwändigste Teil. Hier wird die rechtliche „Sauberkeit“ des Startups geprüft.
- Corporate: Ist die GmbH/AG sauber gegründet? Sind alle Gesellschafterlisten korrekt beim Handelsregister? Ist der Cap Table sauber?
- Cap Table: Gehören die Anteile wirklich denen, die im Cap Table stehen? (Besonders wichtig: „Dead Equity“ von ausgeschiedenen Gründern).
- Mitarbeiter: Sind alle Arbeitsverträge gültig? Wurden Scheinselbstständigkeiten vermieden?
- Verträge: Sind die Verträge mit den wichtigsten Kunden (Key Accounts) und Lieferanten wasserdicht?
- IP (Intellectual Property): Der kritischste Punkt. Gehört das geistige Eigentum (Code, Marke, Patente) wirklich zu 100 % der Firma? Oder liegt es (aus Versehen) noch privat bei einem Gründer oder einem externen Freelancer?
2. Financial Due Diligence (FDD)
Hier werden die Finanzen der Vergangenheit und die Plausibilität der Zukunft geprüft.
- Ist-Zahlen: Überprüfung der Bilanzen, BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) und der GuV (Gewinn- und Verlustrechnung).
- Metriken: Validierung der vom Startup präsentierten KPIs (z. B. MRR, ARR, Churn Rate). Sind diese Zahlen „geschönt“ oder korrekt berechnet?
- Finanzplanung: Ist der Business Plan realistisch? Passen die Annahmen für Wachstum und Kosten (Cash Burn)?
3. Commercial (Markt-) Due Diligence
Passt das Produkt zum Markt?
- Markt & Wettbewerb: Analyse der Marktgröße (TAM, SAM) und der Wettbewerbslandschaft.
- USP: Ist der „Unique Selling Proposition“ (das Alleinstellungsmerkmal) wirklich so stark wie behauptet?
- Kunden: Es werden oft Referenzgespräche mit den wichtigsten Kunden geführt.
4. Technical Due Diligence
Dies ist entscheidend bei Tech-Startups (Software, Deeptech).
- Architektur: Ist die Software skalierbar oder muss sie bei 10.000 Nutzern neu gebaut werden?
- Code-Qualität: Ist der Code sauber dokumentiert oder „Spaghetti-Code“?
- IP-Risiken: Wurden Open-Source-Lizenzen verwendet, die das eigene Geschäftsmodell gefährden (Stichwort: Copyleft-Lizenzen)?
Wie läuft eine Due Diligence in der Praxis ab?
- Term Sheet (LoI): Investor und Startup einigen sich auf die Eckpunkte (Bewertung, Investment-Summe) und unterzeichnen ein (meist nicht bindendes) Term Sheet.
- DD-Checkliste: Das Startup erhält vom Investor eine oft Dutzende Seiten lange Checkliste mit allen angeforderten Dokumenten.
- Einrichten des Data Room: Das Startup richtet einen virtuellen Datenraum (VDR) ein – einen hochsicheren Cloud-Ordner (z. B. bei Anbietern wie Drooms, Intralinks oder Box) – und lädt Hunderte von Dokumenten hoch.
- Q&A-Prozess: Das Investoren-Team prüft die Dokumente und stellt über den Datenraum formalisierte Rückfragen. Dies kann mehrere Wochen dauern und bindet enorme Ressourcen im Gründerteam (insbesondere der Geschäftsführung).
- DD-Report: Die Prüfer erstellen einen finalen Report für den Investor, der alle „Findings“ (Erkenntnisse) und „Red Flags“ auflistet.
- Finale Entscheidung: Basierend auf dem Report entscheidet der Investor: „Go“ (Vertragsverhandlung), „Go mit Anpassungen“ (z. B. niedrigere Bewertung) oder „No-Go“ (Deal-Abbruch).
Was bedeutet das für Gründer? (Vorbereitung)
Due Diligence ist kein einmaliges Event, sondern sollte ein Dauerzustand sein. Gründer, die „Fundraising-Ready“ sein wollen, müssen ihre „DD-Readiness“ sicherstellen.
- Seien Sie vorbereitet: Warten Sie nicht auf die DD-Anfrage. Führen Sie einen „Permanent Data Room“ und halten Sie alle Verträge, Bilanzen und HR-Dokumente von Tag 1 an sauber und geordnet.
- „Clean House“-Prinzip: Klären Sie rechtliche Probleme (z. B. fehlende IP-Übertragungen) bevor Sie in den Fundraising-Prozess gehen.
- Transparenz: Versuchen Sie niemals, Probleme zu verstecken. Die Experten des Investors werden sie finden. Ein gefundenes (und verschwiegenes) Problem zerstört das Vertrauen und beendet den Deal. Ein offen kommuniziertes Problem ist ein Verhandlungspunkt. Music for Startups: Urheberrecht und Lizenzierung einfach erklärt