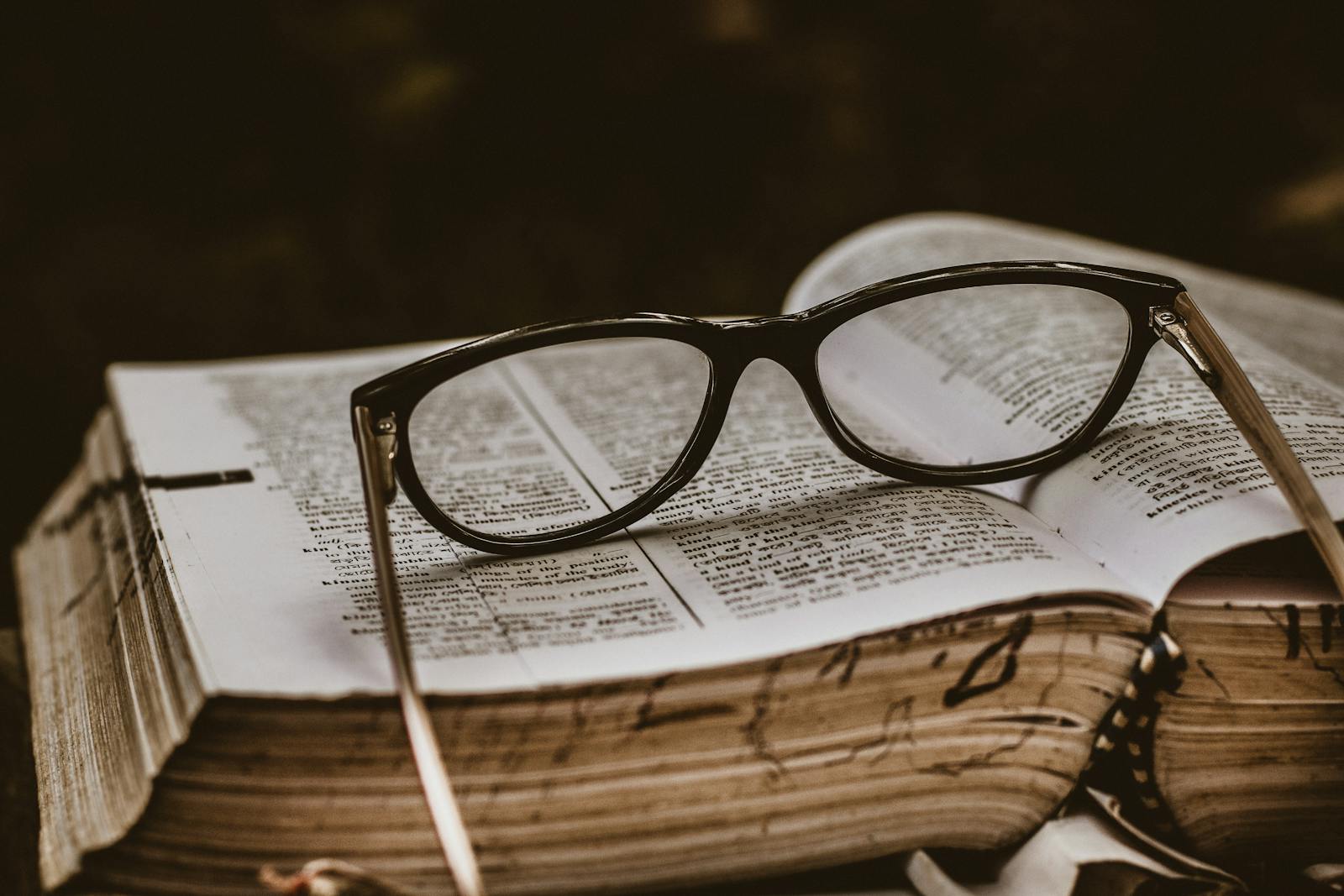Die „Founders Lock-up“ (oder Lock-in Period) ist eine vertragliche Klausel, die Gründer (und oft auch andere frühe Gesellschafter) daran hindert, ihre Unternehmensanteile für einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen, zu verpfänden oder anderweitig zu übertragen.
Diese Bindungsfrist ist ein Standard-Bestandteil in zwei primären Situationen: bei Venture-Capital-Finanzierungsrunden (im Beteiligungsvertrag/SHA) und beim Börsengang (IPO) eines Unternehmens. Ihr Hauptzweck ist die Sicherstellung von Stabilität, die Angleichung von Interessen (Alignment) und die Demonstration von langfristigem Commitment gegenüber Investoren und dem Markt.
Das Wichtigste in Kürze
- Definition: Ein „Lock-up“ ist eine vertragliche Bindungsfrist, die Gründern den Verkauf oder die Übertragung ihrer Anteile für einen definierten Zeitraum (z. B. 180 Tage nach IPO) verbietet.
- Zweck (VC-Finanzierung): Die Klausel stellt sicher, dass Gründer langfristig an das Unternehmen gebunden bleiben und ihre Interessen parallel zu den Investoren laufen (kein „Early Exit“ der Gründer).
- Zweck (Börsengang/IPO): Sie verhindert, dass Insider (die die meisten Anteile halten) den Markt direkt nach dem IPO mit ihren Aktien fluten, was den Aktienkurs massiv destabilisieren würde.
- Konsequenz für Gründer: Die Anteile der Gründer sind illiquide („Papiervermögen“). Sie können nicht realisiert werden, bis die Frist abläuft, was das persönliche Engagement für den langfristigen Erfolg unterstreicht.
Die zwei Hauptanwendungsfälle eines Lock-ups
Die Motivation für die Klausel unterscheidet sich je nach Phase des Unternehmens.
1. Lock-up in Finanzierungsrunden (Venture Capital)
In Beteiligungsverträgen (SHAs) fordern VCs fast immer Lock-up-Klauseln für die Gründer. Der Investor investiert in das Team und dessen Vision. Der Lock-up stellt sicher, dass die Gründer „all-in“ bleiben.
Er verhindert, dass Gründer ihre Anteile (z. B. in einer kleinen Sekundär-Transaktion) verkaufen und damit ihr persönliches finanzielles Risiko reduzieren, während der Investor noch das volle Risiko trägt. Es signalisiert: „Wir sitzen alle im selben Boot bis zum gemeinsamen, strategischen Exit.“
2. Lock-up beim Börsengang (IPO)
Dies ist die bekannteste Form des Lock-ups. Beim IPO wird die Frist (typischerweise 180 Tage) von den Emissionsbanken (Underwritern) und der Börsenaufsicht zur Bedingung gemacht.
Wenn die Gründer, die oft 50 % oder mehr der Anteile halten, ihre Aktien am ersten Handelstag verkaufen dürften, würde das Angebot die Nachfrage schlagartig übersteigen und der Kurs abstürzen. Der Lock-up schützt die neuen, öffentlichen Aktionäre vor dieser Volatilität und signalisiert das Vertrauen des Managements in den zukünftigen Wert des Unternehmens.
Was bedeutet das für Gründer?
Ein Lock-up schränkt die persönliche finanzielle Flexibilität drastisch ein. Selbst wenn das Unternehmen auf dem Papier Milliarden wert ist, können die Gründer ihr Vermögen nicht liquidieren.
- Interessenangleichung: Die Klausel zwingt Gründer, ihre Entscheidungen auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens auszurichten, da ihr eigener finanzieller Erfolg direkt daran gekoppelt ist.
- Verhandlungsspielraum: Während die Existenz eines Lock-ups (besonders beim IPO) nicht verhandelbar ist, können in seltenen Fällen bei VC-Runden die Details verhandelt werden (z. B. Ausnahmen für kleine Verkäufe zur Deckung von Steuerschulden).
- Signalwirkung: Ein Gründer, der versucht, den Lock-up zu umgehen, sendet ein katastrophales Signal an Investoren. Es impliziert, dass er nicht an den langfristigen Erfolg glaubt.
Abgrenzung: Lock-up vs. Vesting
Diese beiden Begriffe werden oft verwechselt, bedeuten aber fundamental Unterschiedliches.
- Vesting (Erdienen): Regelt den Erwerb von Anteilen über die Zeit. Es ist ein Anreiz, im Unternehmen zu bleiben. Verlässt ein Gründer das Unternehmen (siehe „Bad Leave“), verliert er seine noch nicht gevesteten Anteile.
- Lock-up (Verkaufsverbot): Regelt den Verkauf von bereits gehaltenen Anteilen. Ein Gründer kann 100 % seiner Anteile „gevested“ haben und unterliegt trotzdem einem Lock-up. Es ist ein Instrument zur Marktstabilität und Interessensangleichung